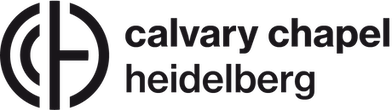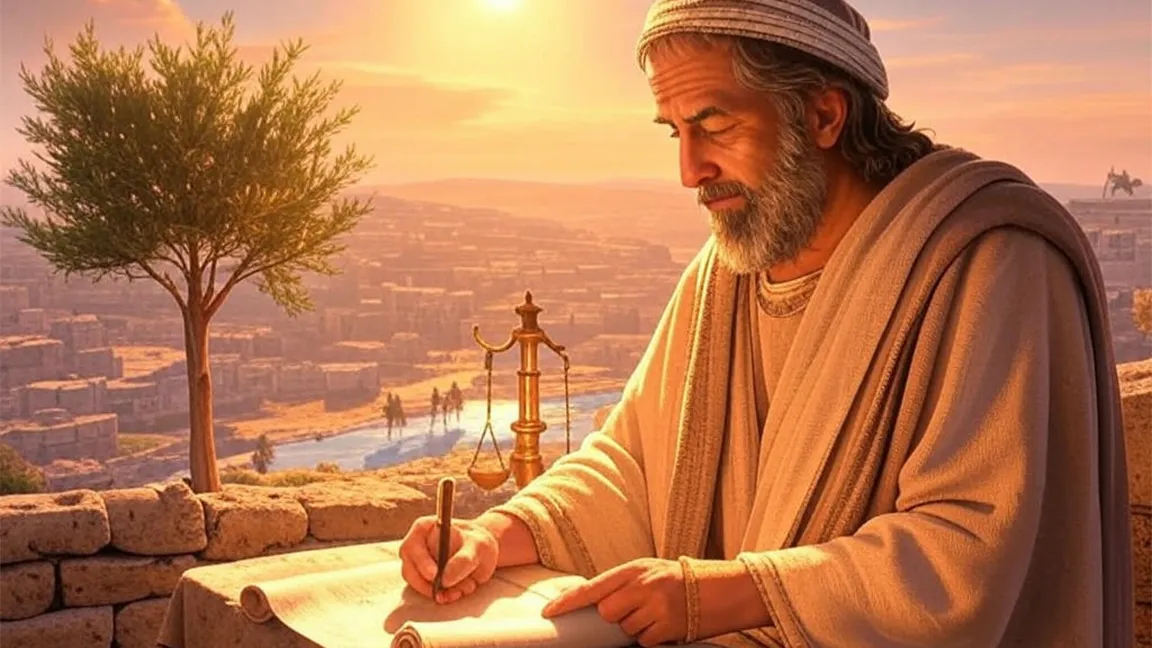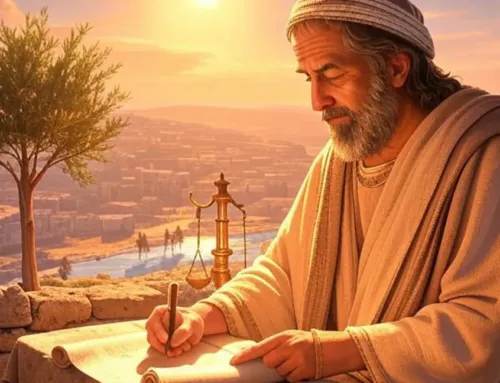Einleitung
Es gibt Nächte, in denen man aufschreckt – gefangen in einem Albtraum. Die Bilder wirken real, das Herz rast, die Angst ist greifbar. Und doch: Beim Aufwachen erkennt man erleichtert, dass es nur ein Traum war. Die Wirklichkeit ist eine andere.
Doch was, wenn die Realität sich wie ein Albtraum anfühlt? Genau so ging es dem Volk Israel zur Zeit des Propheten Sacharja. Obwohl sie auf Gottes Ruf hin umgekehrt waren und mit dem Tempelbau begannen, war ihre Lebenssituation weiterhin geprägt von äußerer Bedrängnis, innerer Schwäche und tiefer Unsicherheit. Kein König, kein vollendeter Tempel, wirtschaftliche Not, politische Abhängigkeit. Die Lage war dunkel – wie eine Nacht ohne Morgen.
In genau diese Nacht hinein empfängt Sacharja eine Vision. Es ist die erste von acht Nachtgesichten, die Gott ihm zeigt – und sie beginnt nicht mit Worten, sondern mit einem Bild. Ein Bild, das Hoffnung weckt und den Blick auf eine tiefere Wirklichkeit lenkt: Gottes Gegenwart mitten in der Not.
Hauptteil
Bibeltext: Sacharja 1,7–17
Vers 7–8: „Am vierundzwanzigsten Tag des elften Monats, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des HERRN an Sacharja […]. Ich schaute in der Nacht, und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt, und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde.“
In Vers 7 beginnt der nächste Abschnitt im Buch Sacharja mit einer zeitlichen Einordnung: „Am vierundzwanzigsten Tag des elften Monats, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des HERRN an Sacharja […]“ – und genau da würden wir eigentlich Worte erwarten. So ist es in der Regel, wenn das Wort des HERRN an einen Propheten ergeht: Es folgt eine sprachliche Mitteilung. Doch in diesem Fall ist es anders.
Denn statt einer hörbaren Botschaft schildert Sacharja in Vers 8 etwas anderes: „Ich schaute in der Nacht.“ Das heißt, er hört zunächst nichts. Gott spricht nicht durch Worte, sondern durch ein Bild. Das ist bemerkenswert. Es ist eine visuelle Offenbarung, eine von mehreren in dieser Reihe von Nachtvisionen. In Hebräer 1 heißt es, dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern gesprochen hat – durch die Propheten. Genau das geschieht hier. Es ist eine andere Art der Kommunikation – nicht weniger bedeutungsvoll, sondern im Gegenteil: Gott begegnet in diesen Visionen ganz bewusst auch unseren Gefühlen, unseren Emotionen. Es ist seine Art, das Herz direkt anzusprechen – durch starke, wirkungsvolle Bilder.
Ich hoffe sehr, dass wir beim gemeinsamen Betrachten dieser acht Nachtvisionen einen Zugang zu dieser Bildsprache finden. Dass diese kraftvollen Visionen unsere Herzen erreichen und wir erleben dürfen, wie Gott uns durch sie begegnet – gerade auch in Situationen, in denen wir mutlos oder verzweifelt sind. Denn diese Bilder sind nicht abstrakt oder fern, sondern sehr konkret – sie sollen Hoffnung geben. Und genau das war damals notwendig.
In diesem Zusammenhang habe ich gesagt: Es ist, als ob Gott in diesen Visionen den Vorhang der sichtbaren Welt beiseitezieht, um Sacharja – und durch ihn dem Volk Israel und auch uns heute – einen Blick auf die geistliche Wirklichkeit zu schenken. Diese geistliche Realität ist nicht weniger wirklich als das, was wir mit unseren Augen sehen. Im Gegenteil. In den acht Nachtvisionen entfaltet Gott in wunderschöner Weise seinen Plan – seinen Heilsplan. Es ist ein Rettungsplan für das verängstigte, kleine, unbedeutende Israel. Und darüber hinaus auch für die ganze Menschheit.
Im Laufe dieser Visionen wird eine Person im Mittelpunkt stehen – eine zentrale Gestalt in Gottes Rettungshandeln. Sie wird unter anderem als der Spross bezeichnet. Es ist der Messias, der Priesterkönig. Und wir werden sehen, dass dieser Messias durch Leiden und Tod eine Quelle zur Reinigung von Sünde öffnet. Dass er den Tempel des HERRN bauen wird. Und dass durch ihn die segnende und gütige Gegenwart Gottes wieder in der Mitte seines Volkes wohnen wird.
In Johannes 1 sehen wir einen Hinweis darauf: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist genau das, was Sacharja hier vorbereitet sieht – die ewige Friedensherrschaft des Priesterkönigs. Und wenn Gott sich so viel Mühe gibt, diese acht Visionen zu zeigen, dann ist das kein Zufall. Sowohl der Inhalt als auch die Anordnung dieser Visionen haben eine Bedeutung.
Ich habe dazu ermutigt, diese Visionen – Kapitel 1 bis einschließlich Kapitel 6 – mehrmals zu lesen. Denn es gibt darin Verbindungen: Die erste Vision korrespondiert mit der achten, die zweite mit der siebten, die dritte mit der sechsten und die vierte mit der fünften. Das ist nicht nur literarisch schön, sondern auch inhaltlich bedeutungsvoll. Es ist eine in der hebräischen Literatur häufig genutzte Struktur, bei der die Mitte besonders betont wird. Und in der Mitte dieser acht Visionen stehen die vierte und fünfte – es geht dort um die Reinigung und Wiederherstellung des Priestertums und des Königtums. Das ist das Zentrum: der Messias als Priester und König.
<!–nextpage–>
Die Visionen lassen sich auch geographisch nachvollziehen. Es beginnt außerhalb Jerusalems, bewegt sich dann hinein in die Stadt, hinein in den Tempel, hinein ins Allerheiligste – ins Zentrum des Glaubens. Und von dort gibt es eine Bewegung nach außen, in die Welt hinein, die durch Gottes Gericht und Gnade unter die Herrschaft dieses Priesterkönigs kommt.
Diese thematische Entwicklung ist tief und beeindruckend: Sie beginnt mit Befreiung, führt zur Reinigung und Wiederherstellung durch den Messias – und mündet schließlich in Segen für die Nationen und Gericht über die Feinde Gottes.
Und jetzt – ganz konkret in Vers 8 – beginnt das erste Bild:
„Ich schaute in der Nacht, und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde.“
Diese Formulierung – „Ich schaute in der Nacht, und siehe, ein Mann“ – lenkt unseren Blick ganz bewusst auf eine zentrale Figur. Für Sacharja war es ganz klar, wer hier im Mittelpunkt der Vision steht. Die Szene zeigt ihn auf einem roten Pferd, vermutlich als Anführer weiterer Reiter, die hinter ihm stehen. Es ist dieser eine Mann, der hervorgehoben wird.
Er steht zwischen den Myrten. Diese Bäume sind klein, immergrün, unscheinbar. Sie erreichen eine Höhe von etwa zwei bis drei Metern. Sie wurden unter anderem beim Laubhüttenfest verwendet, etwa zum Bau von Hütten (vgl. Nehemia). In der Bibel sind große Bäume wie Zedern oft ein Bild für Könige oder Mächtige. Die Myrte hingegen ist ein Bild für Israel in seiner Niedrigkeit – klein, unbedeutend, unbeachtet.
Und doch steckt darin eine Hoffnung. In Jesaja 55,13 wird die Myrte als Zeichen dafür beschrieben, dass Gott handelt – dass etwas Neues wächst, dass Wiederherstellung beginnt. Statt Dornen wächst Myrte. Die Myrte ist also nicht nur ein Bild für das niedrige Israel, sondern zugleich für das beginnende Erbarmen Gottes.
Ein weiteres Detail ist der Ort: der Talgrund. Auch das ist ein sprechendes Bild für den Zustand des Volkes. Sie waren tief gefallen, bedrückt, gebeugt. Und es war Nacht – ein Bild der Dunkelheit, der Bedrohung, der Ungewissheit. Es erinnert an Psalm 23, an das „Tal des Todesschattens“.
Und genau dort, mitten im Dunkel, in der Tiefe, in der Unsicherheit, steht dieser eine Mann. Was für ein ermutigendes Bild für Sacharja – und für das Volk. Ja, es ist schwer. Ja, es ist dunkel. Aber dieser Mann ist da. Und seine Anwesenheit verändert alles. Sie gibt Hoffnung, sie gibt Mut, sie schenkt neue Perspektive.
Diese Nachtvision beginnt mit einer dunklen Szene – aber sie ist voller Licht, weil er da ist. Und damit ist die Grundlage gelegt für alles, was nun folgt.
Vers 9–11: „Mein Herr, wer sind diese? […] Der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach: Diese sind es, die der HERR ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen. […] Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig.“
Nachdem Sacharja in Vers 8 das nächtliche Bild geschildert hat – einen Mann auf einem roten Pferd, der zwischen Myrtenbäumen im Talgrund steht, umgeben von weiteren Pferden in Rot, Hellrot und Weiß – geht es in den folgenden Versen um die Deutung dieses Bildes. Es ist auffällig, dass Sacharja, nachdem er diese eindrucksvolle Szene gesehen hat, nicht einfach schweigt oder staunt, sondern eine Frage stellt: „Mein Herr, wer sind diese?“ (V. 9). Das zeigt seine Haltung: Er will verstehen, er ist offen für Gottes Reden, aber er braucht Erklärung.
<!–nextpage–>
Und an dieser Stelle tritt nun ein weiterer Engel auf – eine neue Figur, die in den kommenden Visionen wiederholt auftreten wird. Es ist der sogenannte Erklärengel, ein Bote Gottes, der Sacharja hilft, die nächtlichen Bilder zu deuten. Dieser Engel antwortet auf Sacharjas Frage mit den Worten: „Ich will dir zeigen, wer diese sind.“ (V. 9). Er verspricht also Aufklärung. Doch er beantwortet die Frage nicht direkt, sondern lässt stattdessen den Mann auf dem roten Pferd selbst zu Wort kommen.
In Vers 10 lesen wir: „Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach: Diese sind es, die der HERR ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen.“ Damit wird deutlich: Die Pferde – und vermutlich die Reiter, die sie tragen – sind Boten Gottes. Sie sind ausgesandt, um die Erde zu durchziehen, das heißt: Sie haben eine beobachtende, berichtende Funktion. Sie sind keine eigenständigen Akteure, sondern handeln im Auftrag des Herrn.
In Vers 11 folgt dann der Bericht dieser Boten: „Sie antworteten dem Engel des HERRN, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig.“ Dieser Vers ist theologisch und seelsorgerlich von zentraler Bedeutung.
Erstens fällt auf, an wen sich die Boten wenden: an den Engel des HERRN, der in Vers 8 als der Mann auf dem roten Pferd vorgestellt wurde. Das unterstreicht seine Autorität und seine herausragende Rolle innerhalb des nächtlichen Geschehens. Er ist nicht nur Beobachter, sondern der Befehlshaber dieser Reiter.
Zweitens ist bemerkenswert, was die Reiter berichten: Die ganze Erde sei still und ruhig. Auf den ersten Blick klingt das wie eine gute Nachricht – Frieden, keine Unruhen, eine stabile Lage. Doch in ihrem Zusammenhang bekommt diese Aussage eine doppelte Bedeutung. Denn während die Welt zur Ruhe gekommen ist, befindet sich das Volk Gottes weiterhin in einer unsicheren, belastenden Situation. Sie sind umgekehrt, sie haben mit dem Bau des Tempels begonnen – und dennoch leben sie unter politischem Druck, in wirtschaftlicher Not, bedroht von außen und innen. Ihre Realität gleicht einem Albtraum.
Und deshalb ist diese Nachricht – „die Erde sitzt still und ist ruhig“ – keine frohe Botschaft. Denn sie bedeutet im Umkehrschluss: Die Weltmächte sind unbehelligt, es gibt keine göttliche Erschütterung der Nationen, wie sie etwa im Propheten Haggai angekündigt war. Die Verheißung der Ruhe für das Volk Gottes ist noch nicht erfüllt – aber die Völker ruhen. Das ist eine schmerzvolle Spannung.
Diese Verse zeigen eine grundlegende Wahrheit: Gott weiß, was in der Welt geschieht. Er kennt den Zustand seines Volkes, er hat seine Boten ausgesandt, sie haben berichtet – und nichts entgeht ihm. Doch es scheint zunächst so, als ob Gottes Handeln noch aussteht. Es ist diese Spannung, in der sich das Volk befindet – eine Spannung zwischen Verheißung und Erfahrung, zwischen Umkehr und unerfülltem Heil. Und genau in diese Spannung hinein wird im nächsten Vers eine Stimme laut, die für das Volk eintritt.
In Vers 12 geschieht etwas zutiefst Bewegendes: Nach dem Bericht der Reiter, dass die Erde still und ruhig sei, erhebt der Engel des HERRN seine Stimme. Und was er sagt, ist keine Anweisung, keine Erklärung – es ist ein Gebet. Ein eindringliches, flehentliches Gebet an den HERRN der Heerscharen:
Vers 12: „Da antwortete der Engel des HERRN und sprach: HERR der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, auf die du zornig warst diese siebzig Jahre?“
Diese Worte sind von zentraler Bedeutung – theologisch wie auch seelsorgerlich. Denn sie zeigen: Der Engel des HERRN, der zuvor als Mann auf dem roten Pferd zwischen den Myrten identifiziert wurde, tritt nun als Fürsprecher für das Volk ein. Er sieht die Realität des Volkes – ihre Niedrigkeit, ihre Bedrängnis, ihre Unsicherheit – und ruft zum Vater im Himmel: „Wie lange noch?“
Das Erschütternde ist: Nicht das Volk bittet hier, sondern der Engel des HERRN selbst bittet für das Volk. Es ist nicht Sacharja, der fleht, sondern der Sohn Gottes – der sich inmitten der Myrten, mitten im Tal der Dunkelheit befindet – und betet. Und dieses Gebet ist kein allgemeines Bitten, sondern ein sehr konkretes Erinnern an Gottes eigene Verheißung: Die siebzig Jahre des Zorns, die Gott selbst angekündigt hatte, sind beinahe erfüllt.
Ich habe dazu gesagt: Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser ersten Nachtvision. Denn was hier geschieht, ist nichts anderes als das, was wir im Neuen Testament über unseren Herrn Jesus lesen: Er lebt, um für uns zu bitten. Er, der Sohn Gottes, tritt beim Vater für sein Volk ein – damals wie heute.
Diese Szene zeigt uns das tiefe Mitgefühl des Engels des HERRN – seines Sohnes. Er kennt die Lage des Volkes. Er weiß um die Not, um die Fragen, um die Spannung zwischen Verheißung und Realität. Und er nimmt sich dieser Not an – nicht distanziert, sondern betend, flehend, mit innerer Bewegung.
Das Erbarmen, um das er bittet, ist nicht einfach eine vage Hoffnung. Es ist gegründet auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißung. Und genau das macht dieses Gebet so kraftvoll: Es stellt sich auf das, was Gott selbst angekündigt hat.
Wir dürfen uns fragen: Wer betet hier für das Volk? Die Antwort ist klar: Der Engel des HERRN – der Sohn Gottes. Er wendet sich im Gebet an Gott, den allmächtigen Vater, an den HERRN der Heerscharen.
Was bedeutet das für uns? Es bedeutet: Jesus selbst betet für sein Volk. Nicht irgendwann, nicht theoretisch – sondern konkret, mitten in der Not, mitten im Tal, mitten in der Nacht. Das ist eine tief tröstliche Wahrheit. Es zeigt, dass wir nicht allein sind – selbst wenn es dunkel ist, selbst wenn wir uns fragen, wie es weitergeht.
<!–nextpage–>
Und dieses Gebet bleibt nicht unbeantwortet. Aber bevor wir zur Antwort kommen – zu den Worten, die Gott darauf spricht –, halten wir noch einmal inne und lassen uns diese gewaltige Szene vor Augen führen: Der Sohn Gottes steht inmitten der Niedrigkeit seines Volkes – und er betet für sie.
Vers 13–15: „Und der HERR antwortete dem Engel […] mit guten, tröstlichen Worten: Ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und Zion geeifert und mit großem Zorn zürne ich über die Nationen, […] denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen.“
Auf das Gebet des Engels des HERRN, auf seine eindringliche Fürbitte für Jerusalem und die Städte Judas, folgt nun in Vers 13 die Reaktion Gottes:
„Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir redete, mit guten, tröstlichen Worten.“
Was für ein Moment. Wir dürfen hier miterleben, wie Gott selbst antwortet – nicht mit Schweigen, nicht mit Distanz, sondern mit guten und tröstlichen Worten. Und es ist wichtig zu sehen, wem diese Worte gelten: Der HERR spricht sie zu dem Engel, der mit Sacharja redet – also zu dem Erklärengel. Doch der Inhalt dieser Worte – das ist Gottes Antwort auf das Gebet des Engels des HERRN, auf das Bitten seines Sohnes für das Volk.
Das ist für mich eine gewaltige und zutiefst tröstende Wahrheit: Der Vater antwortet dem Sohn – mit Trost, mit Güte, mit Zuspruch. Und das ist nicht nur eine schöne Szene aus der Geschichte Israels – das ist auch heute die Realität: Jesus betet für uns – und der Vater antwortet. Nicht mit Härte, sondern mit Barmherzigkeit. Nicht mit Abweisung, sondern mit tröstenden Worten.
In Vers 14 beginnt der Engel, der mit Sacharja redet – also der Erklärengel –, diese tröstliche Antwort Gottes laut zu verkündigen. Es heißt:
„Und der Engel, der mit mir redete, sprach: Ruf aus und sprich: So spricht der HERR der Heerscharen: Ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und Zion geeifert.“
Das Erste, was wir hier hören, ist der Eifer Gottes. Es ist ein göttlicher Eifer – ein Ausdruck leidenschaftlicher, nicht nachlassender Liebe. Gottes Eifer zeigt, dass ihm sein Volk nicht egal ist. Er sieht ihre Not, ihre Niedrigkeit – und es bewegt ihn zutiefst. Diese Aussage ist eine Antwort auf die Frage aus Vers 12: „Wie lange noch?“ Die Antwort lautet: Ich habe geeifert. Ich bin nicht passiv. Ich bin innerlich bewegt.
Und das führt direkt zu Vers 15:
„Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen; denn ich habe nur ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen.“
Hier wird Gottes Zorn deutlich – nicht gegenüber seinem Volk, sondern gegenüber den Nationen. Und dieser Zorn ist ebenso leidenschaftlich wie sein Eifer. Warum? Weil Gott zwar sein Volk gezüchtigt hat – aber in einem begrenzten Maß. Er hatte nur „ein wenig gezürnt“, nach seinem Maß, nach seinem Plan. Doch die Nationen, insbesondere die Babylonier und später auch die Perser, sind über dieses Maß hinausgegangen. Sie haben Israel härter behandelt, als es dem Willen Gottes entsprach. Sie haben „zum Unglück geholfen“ – das heißt: sie haben Gottes Züchtigung missbraucht und daraus Unterdrückung gemacht.
Gott nimmt das nicht hin. Er sieht es. Und er reagiert. Das zeigt: Gottes Zorn ist nicht blinde Wut, sondern gerecht und maßvoll. Und wenn Menschen über dieses Maß hinausgehen, dann weckt das seinen gerechten Zorn.
In diesen Versen – 13 bis 15 – sehen wir einen tiefen Wechsel: Gottes Blick wendet sich voller Barmherzigkeit seinem Volk zu und voller Gerechtigkeit gegen jene, die dieses Volk unterdrücken. Es ist, als ob sich das Blatt nun wendet: Der Zorn über Israel weicht dem Eifer, und der Zorn richtet sich auf die Feinde.
Und all das geschieht, weil der Sohn für das Volk bittet, und der Vater mit tröstenden Worten antwortet. Worte, die nicht nur Zuspruch sind, sondern der Auftakt zu Gottes aktivem Handeln – wie wir im folgenden Vers sehen werden. Doch schon hier wird deutlich: Gott ist nicht gleichgültig. Er ist bewegt – vom Leid seines Volkes und von der Ungerechtigkeit der Mächtigen.
Vers 16–17: „Darum […] Ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden […] Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, und der HERR wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen.“
In Vers 16 finden wir eine der schönsten Zusagen dieser Nachtvision. Nachdem der HERR seinen Eifer für Jerusalem und seinen Zorn über die ungerechten Nationen offenbart hat, wird er nun konkret in seinem Handeln. Es heißt:
„Darum, so spricht der HERR: Ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der HERR der Heerscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden.“
Das ist ein gewaltiger Wendepunkt. Gottes Erbarmen wird aktiv. Es bleibt nicht beim Trostwort, sondern geht über in Wiederherstellung. Und dieses Erbarmen steht am Anfang – das ist entscheidend. Es ist nicht so, dass das Volk durch den Tempelbau Gottes Erbarmen verdient hätte. Nein, es ist genau umgekehrt: Gott erbarmt sich – und deshalb wird gebaut.
Ich habe das deutlich gemacht: Das Volk muss nicht in Vorleistung gehen. Wenn es so wäre, wenn Gottes Erbarmen vom Tun des Volkes abhinge, dann wäre das Religion – aber nicht Gnade. Nein, Gottes Erbarmen ist die Grundlage. Es ist tätiges Mitleid. Es gleicht dem Handeln des barmherzigen Samariters, der nicht fragt, was der Verwundete getan hat, sondern handelt, weil er innerlich bewegt ist.
Und darum wird nun gesagt: „Mein Haus soll gebaut werden.“ Das ist keine Frage, keine Möglichkeit – das ist ein göttlicher Beschluss. Der Tempel wird gebaut. Und die Messschnur, das Planungsinstrument, wird über Jerusalem ausgespannt. Das zeigt: Es ist in Gottes Augen bereits beschlossen. Der Wiederaufbau wird nicht nur erlaubt, sondern sicher stattfinden.
<!–nextpage–>
Dann folgt in Vers 17 eine weitere Zusage, die diese Hoffnung vertieft:
„Rufe ferner aus und sprich: So spricht der HERR der Heerscharen: Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, und der HERR wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen.“
Gott will nicht nur den Tempel wieder aufbauen. Er will segnen. Es geht um mehr als nur Wiederherstellung – es geht um Überfluss. „Meine Städte sollen überfließen von Gutem.“ Was für eine Zusage! Das bedeutet: Der Segen Gottes wird nicht spärlich oder knapp sein, sondern überreich.
Und es geht noch weiter: „Der HERR wird Zion wieder trösten.“ Das zeigt: Sein Trost bleibt nicht abstrakt – er richtet auf, er heilt, er erneuert. Und schließlich: „Er wird Jerusalem wieder erwählen.“ Diese Formulierung macht deutlich: Gottes Wahl steht, auch nach der Zeit des Gerichts. Er hat sein Volk nicht verworfen, sondern er erneuert seine Erwählung. Seine Treue bleibt bestehen.
Ich habe an dieser Stelle bereits einen Ausblick gegeben auf die folgende Vision, in der gesagt wird, dass Jerusalem keine Mauern mehr haben wird, weil so viele Menschen dort wohnen werden. Jerusalem wird überfließen von Leben und von Gutem. Und wir werden sehen: Auch die Nationen werden Teil des Volkes Gottes. Es wird eine Herde und ein Hirte sein.
Abschluss
Nachdem Gott in den Versen 16 und 17 seine Zusagen von Wiederherstellung, Segen, Trost und Erwählung gemacht hat, endet diese Nachtvision nicht einfach abrupt – sie entfaltet sich in ihrer Wirkung weiter. Es bleibt nicht bei einer theologischen Botschaft, sondern sie mündet in eine tiefgehende geistliche Anwendung.
Ich habe die Zuhörer darauf hingewiesen, dass man in Esra Kapitel 6 nachlesen kann, wie die Antwort von Darius, dem persischen König, tatsächlich ausgefallen ist. Und es ist bemerkenswert: Gott hat es geführt, dass der König nicht nur den Weiterbau des Tempels erlaubt, sondern sogar angeordnet hat, dass die umliegenden Völker das jüdische Volk unterstützen – mit allem, was sie brauchten. So gnädig ist Gott. So souverän. So allmächtig – für sein Volk.
Und dann habe ich den Bogen in unsere Gegenwart geschlagen. Diese Vision, dieses Bild vom Mann auf dem roten Pferd inmitten der Myrtenbäume, zeigt uns eine bleibende Realität: Wir haben einen souveränen Herrn. Und dieser Herr ist bei uns. Nicht fern, nicht abwartend – sondern mitten in unseren Herausforderungen, mitten in unseren „Nachtzeiten“, mitten in den Momenten, die sich wie ein Albtraum anfühlen.
Deshalb – so habe ich es gesagt – brauchen wir uns nicht zu fürchten. Weil jemand Größeres bei uns ist. Jemand, der für uns ist. Jemand, der für uns zum Vater betet.
Ich habe das Bild der Myrtenbäume noch einmal aufgenommen: Klein, unscheinbar, unbedeutend. Und doch ein Bild des beginnenden Erbarmens. Jesus nennt seine Nachfolger „kleine Herde“ – doch er sagt zugleich: „Fürchte dich nicht“. Wir mögen klein erscheinen, aber wir sind nicht allein.
Jesus selbst hat gesagt:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit.“
Das gilt. Das ist unsere Hoffnung. Er ist mit uns.
Zum Abschluss habe ich Hebräer 7,25 gelesen. Dort heißt es:
„Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten.“
Was für ein Trost: Jesus lebt – und er tritt für uns ein. Er ist unser ewiger Hoherpriester. Nicht nur damals für das Volk Israel – sondern jetzt für uns. Und weil er das tut, weil er beim Vater für uns bittet, dürfen wir wissen: Wir sind getragen.
Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, dass man nach einem Albtraum aufwacht und erleichtert ist, dass es „nur ein Traum“ war. Doch diese Nachtvision funktioniert umgekehrt: Sie ist geistlich wahr – und sie hat die Kraft, unsere manchmal albtraumhafte Realität zu verändern. Gottes geistliche Wirklichkeit darf – und soll – unsere Sicht auf die gegenwärtige Realität prägen.
All das geschieht wegen diesem einen Mann, der unter den Myrten steht. Der präsent ist. Der betet. Der rettet.